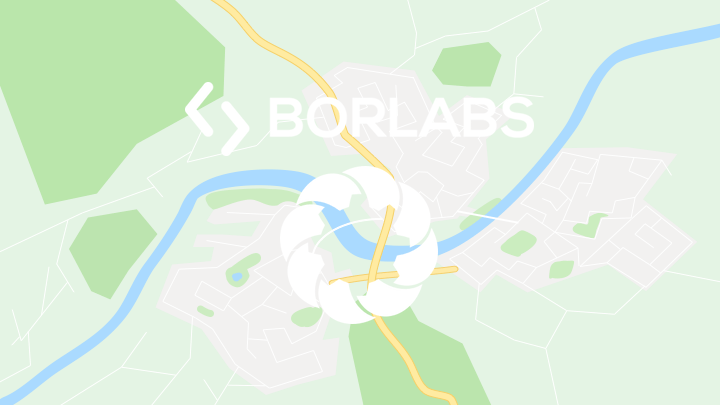von Cat Spangehl, Crew-Mitglied auf der Nadir auf Mission 2/2023 (April/Mai):
Die zweite Beobachtungsmission der Nadir ist geprägt von der massenhaften Flucht aus Tunesien, der Überforderung der italienischen Behörden und den katastrophalen Zuständen auf der Insel Lampedusa. Im zweiten Quartal 2023 begeben sich so viele Menschen auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer wie seit 2017 nicht mehr. Unsere Crew konnte auf dieser Mission etwa 580 Menschen helfen, an einen sicheren Ort zu kommen. Sie waren auf zwölf Boote verteilt.
In den zwei Wochen, die wir unterwegs sind, werden mindestens 350 Menschen auf diesem Weg ertrinken, während die Schiffe der zivilen Seenotrettung in italienischen Häfen blockiert sind. Diese Entwicklungen, und auch die bitteren Erfahrungen der vorherigen Crew, begleiten uns auf dem Weg von Gozo ins Einsatzgebiet. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir unter diesen Bedingungen mit unseren begrenzten Ressourcen sinnvoll handeln können, und wo unsere physischen und psychischen Grenzen liegen. Wenn Fall auf Fall folgt, ab welchem Punkt darf man sich entscheiden eine Pause zu machen, um Schlaf zu bekommen? Wenn so viele Boote gleichzeitig kommen, wie entscheiden, welchem zuerst geholfen wird? Und wie mit den Konsequenzen umgehen, wenn diese Entscheidungen falsch sind? Zeitgleich finden in Tunesien Hetzjagden auf schwarze Menschen statt.
“There is no safety anymore”
Über Funk und E-Mail erreichen uns bereits unterwegs kontinuierlich Meldungen über Seenotfälle. Es ist klar, dass wir bei Eintreffen im Einsatzgebiet sehr schnell auf das erste Boot treffen werden, und so kommt es dann auch. Nachdem wir ein Mayday Relay abgesetzt und Rettungswesten ausgeteilt haben, warten wir auf Rückmeldung aus Rom.
Obwohl wir kein Rettungsschiff sind und dies auch immer kommunizieren, bittet uns die italienische Seenotrettungsleitstelle (MRCC) so schnell wie überraschend, die Menschen an Bord zu nehmen und nach Lampedusa zu bringen. Später bekommen wir über Funk mit, wie Fischer über Stunden neben Booten verharren und immer wieder von den italienischen Behörden vertröstet werden. Es gäbe eine Warteliste – die Küstenwache scheint völlig überfordert.
Wir beginnen die Personen mit dem Beiboot zur Nadir zu bringen. Die Menschen sind seit drei Tagen auf See und sehr erschöpft. Sie haben Schwierigkeiten, die Leiter aufs Deck hinaufzusteigen und müssen von der Besatzung an Bord gehievt werden. Die Menschen kommen aus Westafrika. Sie erzählen, dass sie bereits in Tunesien gelebt und gearbeitet hätten, dort aber nicht mehr sicher sind. Menschen ohne Aufenthaltstitel würden auf der Straße gejagt, verprügelt oder erschossen. „We have no protection. We cannot go to the police, they don’t help.”
Lampedusa I: Dystopische Zustände
In Lampedusa erwartet uns ein Aufgebot an Frontex, Staatspolizei, UNHCR, Gesundheitsamt, Kamerateams und Krankenwagen. Während unsere Gäste in die eine Richtung von Bord gehen, stehen direkt gegenüber hunderte Menschen Schlange in die andere Richtung, auf die Fähre nach Sizilien. Sie tragen je eine Wasserflasche und eine Plastiktüte mit Proviant, viele sind barfuß. Bewaffnete Polizisten überwachen das Boarding. Es ist ein surreales Bild.
Mitarbeitende der NGO Mediterranean Hope erzählen, dass der Hotspot so überfüllt sei, dass die Menschen draußen auf der nackten Erde schlafen müssten. Ohne Decken. Wir raten unseren Gästen, zumindest die Rettungsdecken von der Überfahrt zu behalten. Sie werden mit diesen Decken noch zwei Stunden in der nächtlichen Kälte am Pier stehen, bis die letzten Personen auf die Fähre geführt worden sind und endlich ein Bus zur Verfügung steht, um sie in das Aufnahmelager zu fahren.
Während wir am nächsten Tag auf die Papiere zum Auslaufen warten, beobachten wir teils dystopisch anmutende Zustände. Immer wieder kommen Busladungen mit geflüchteten Menschen am Hafen an und werden von Polizeieskorten auf Schiffe der Guardia di Finanza verladen (man kommt leider nicht umher, hier diese Terminologie zu verwenden). Tief über den Masten der Nadir fliegen Militärflugzeuge, die ebenfalls Menschen aufs Festland transportieren. Insgesamt sollen so 1.200 Menschen pro Tag aus dem Hotspot evakuiert werden. Ähnlich viele kommen bei gutem Wetter gerade auf Lampedusa an. Die ganze Szenerie ist äußerst beklemmend – ein Bilderbuch-Symbolbild für Rassismus und die postkolonialen Strukturen Europas.
38 Stunden ohne Schlaf
Neben der Nadir ist in diesen Tagen nur die Astral (ein 30-Meter-Segelschiff der NGO Proactiva Open Arms) im Einsatzgebiet unterwegs. Andere Schiffe werden auf Grundlage des neuen Dekrets zur Behinderung der zivilen Seenotrettung in weit entfernte Häfen geschickt. So etwa die Geo Barents, mit Kapazität zur Aufnahme von mehreren hundert Menschen, die mit nur 65 Geretteten nach Ravenna beordert wird, fünf Seetage entfernt im Norden Italiens, und somit bis zum Ende unseres Einsatzes außer Gefecht ist. Ebenso ergeht es der Ocean Viking und der Life Support.
Am Abend werden wir von Alarm Phone auf ein Boot aus Libyen aufmerksam gemacht, das wir nach drei Stunden Anfahrt dank gesendeter Positionsdaten schnell finden. An Bord befinden sich 54 Menschen, die bereits seit drei Tagen unterwegs sind. Sie driften seit sieben Stunden in den Wellen, sind aber ruhig und gefasst. Wir verteilen Rettungswesten und informieren die Behörden. Nach einigen Stunden wird uns zugesagt, dass ein Küstenwachschiff kommen wird, wir aber nicht höchste Priorität hätten. Wir begleiten das kleine Boot im Schein unserer Suchscheinwerfer durch die Nacht, während es zunehmend in Schieflage gerät. Wir stehen etwas sorgenvoll mit den Centifloats (Rettungsschläuchen) auf Standby, bis um halb fünf morgens endlich die italienische Küstenwache kommt.
Kurz nach dem Aufräumen kommen über Funk Positionen von zwei nahegelegenen Seenotfällen. Wir finden beide Boote in ca. einer Seemeile Abstand zueinander und entscheiden zum näherliegenden zu fahren. Das andere Boot wird von einem Fischer begleitet, der wohl auch den Notruf abgesetzt hat. Das Metallboot mit 44 Menschen an Bord macht 4 Knoten Fahrt, liegt jedoch sehr tief in den Wellen. Die Menschen wollen aus eigener Kraft nach Lampedusa weiterfahren. Wir verteilen Rettungswesten und begleiten das Boot. Als die Wellen auf einen Meter ansteigen, geraten Boot und Insassen an ihre Grenzen. Die Fahrt wirkt abenteuerlich und äußerst gefährlich. Die Menschen im Boot winken aufgeregt und rufen uns immer wieder etwas zu. Im Boot stünde Wasser und es sei instabil. Sie kommen mit den Bedingungen kaum noch zurecht und wirken verzweifelt. Dann stoppen sie, es geht nicht mehr.
Das Boot schaukelt bedrohlich in den Wellen und wieder einmal bereiten wir uns auf ein schnelles Eingreifen vor, sollte eine Welle das Boot zum Kentern bringen. Wir rufen die Küstenwache in Lampedusa an und besprechen die Situation. Offenbar gibt es dort momentan keine Kapazitäten für eine Rettung. Wir werden aufgefordert, die Menschen an Bord zu nehmen. Wir bitten um eine schriftliche Bestätigung. Nachdem wir keine Mail erhalten, rufen wir erneut an. Jetzt heißt es, wir müssten per Mail ans MRCC um einen Transportauftrag bitten. Wir schreiben die geforderte E-Mail. Es gibt keine Antwort. Wir rufen in Rom an und werden vertröstet. Wir rufen erneut Lampedusa an, wo man uns nochmals telefonisch den Auftrag zur Bergung erteilt.
Im Boot wird die Lage währenddessen immer verzweifelter. Wir sind das kafkaeske Spiel leid und beginnen auch ohne schriftliche Bestätigung mit der Evakuierung. Obwohl die Menschen „erst“ seit einem Tag auf See sind, sind sie nach den Strapazen bei Seegang in einem schlechten Zustand. Ein Mann klappt zitternd zusammen und ist vor Schmerzen nicht mehr ansprechbar. Auch sie berichten von der Verfolgung in Tunesien. Nachdem die medizinischen Notfälle versorgt sind, feiern wir mit einem kleinen Jungen seinen dritten Geburtstag. Am frühen Abend kommen wir in Lampedusa an und werden wie gehabt von Frontex und Co. in Empfang genommen. Wieder steht gegenüber die Fähre nach Sizilien.
Lampedusa II: im Krisengebiet
Um ein besseres Bild von der Situation auf Lampedusa zu bekommen, fahren wir zum Erstaufnahmelager für Ankommende. Es liegt in einem Tal abseits der Stadt. Die Fläche ist umsäumt von einem fünf Meter hohen massiven Metallzaun, durch den man nur hindurchsehen kann, wenn man unmittelbar davorsteht. Auf den umliegenden Hängen sind Soldaten an Checkpoints positioniert. Wir geben uns auf Nachfrage des Militärs als Journalisten aus und dürfen uns umschauen. Wegen der rauen See in den vergangenen Tagen ist der Hotspot inzwischen so gut wie leer. Nur wenige Menschen bewegen sich zwischen den Überresten, die Zeugnis der vergangenen Tage ablegen: Berge leerer Flaschen, improvisierte Wäscheleinen, Schuhe, dreckige Klamotten, Müll. Überall glänzen die goldenen Fetzen der Rettungsdecken. Noch vor wenigen Tagen waren hier über 3.000 Menschen, dicht an dicht bis vorne zum Tor.
Wir treffen Abé von der Elfenbeinküste. Er sitzt alleine am Zaun und hört Musik. Er berichtet, dass er seit zwei Wochen im Hotspot sitzt und keine Möglichkeit hatte, seine Familie zu benachrichtigen, dass er noch lebt. Er fragt uns, wieso die anderen Menschen weiterdürfen und er nicht. Wieso er hier eingesperrt ist wie in einem Gefängnis, und wie lange noch. Wir können keine Antworten geben. Er möchte nach Deutschland. Ob er Freunde oder Verwandte habe in Europa? Nein, niemand. Wir notieren die Nummer seines Bruders, um ihn zu benachrichtigen, dass Abé lebt, aber leider erreichen wir dort später niemand.
Bis vor ein paar Jahren konnten sich die Menschen, die in Lampedusa ankamen, frei auf der Insel bewegen, in der Stadt Kaffee trinken oder einfach spazierengehen. Mit Corona kam der Zaun, und nach Corona blieb er.
Zurück am Parkplatz treffen wir auf eine aufgeregte Menschenmenge und Fernsehteams. Es sind die Mitarbeitenden des Aufnahmelagers, dessen Leitung bald vom Roten Kreuz übernommen werden soll. Sie machen sich Sorgen um ihre Jobs. Eine der Köchinnen erzählt aufgebracht, dass es nicht genug Lebensmittel gebe, um ausreichend Nahrung für die Menschen zuzubereiten. Sie reden davon, in Streik zu treten. Anschließend besuchen wir den Bootsfriedhof und die beiden lokalen Friedhöfe, die nun als stumme Chronisten neben den Inselbewohnern auch vielen Ertrunkenen eine letzte Ruhestätte bieten. Wir reden nicht mehr viel an diesem Tag.
„Das war nicht schön.“
Am nächsten Morgen fahren wir wieder raus. Die Astral birgt eine Leiche und wird durch das undurchsichtige Prozedere um die Bergung und Hygienevorschriften so lange blockiert, dass sie ihren Einsatz vorzeitig beenden muss. Nun sind wir das einzige Schiff im Einsatzgebiet.
Das zivile Aufklärungsflugzeug Seabird (von Sea-Watch) macht uns gegen 16 Uhr auf einen Seenotfall in der Nähe aufmerksam. Das Stahlboot mit 35 Menschen an Bord fährt noch. Wir berechnen den ungefähren Treffpunkt und nehmen Kurs auf die Position. Lange suchen wir mit Ferngläsern nach dem Boot. Es liegt tief im Wasser und ist so dunkel, dass es in den Wellen kaum auszumachen ist.
Die Wetterbedingungen verschlechtern sich. Das Boot ist offensichtlich sehr instabil und dem Seegang nicht gewachsen, im Inneren steht Wasser. Wir verteilen Rettungswesten und halbierte Plastikflaschen, mit denen die Insassen Wasser ausschöpfen. Das Boot liegt so tief im Wasser, das es fast keinen Freibord mehr hat. Der Anblick des kleinen Boots in den Wellen ist schwer zu ertragen.
Die Situation im Boot wird immer kritischer. Wir bereiten uns auf ein mögliches Kentern vor. Das Beiboot steht mit einem Centifloat bereit. Auch die Beiboot-Crew muss zwischenzeitlich Wasser aus ihrem Boot schöpfen, da immer wieder hohe Wellen hineinschwappen.
Auf der Nadir spielen sich derweil wieder kafkaeske Szenen in der Kommunikation mit den italienischen Behörden ab. Wir werden verwiesen, vertröstet, vermittelt, hingehalten. Niemand möchte uns Auskunft geben, und scheinbar ist auch niemand weisungsbefugt.
Im Stahlboot steht inzwischen das Wasser den Menschen bis zu den Beinen. Sie frieren und können nicht verstehen, wieso wir ihnen nicht helfen, indem wir sie auf unser großes Schiff aufnehmen. Nach weiterem drängenden Hin-und-Her mit Lampedusa und Rom wird uns endlich mitgeteilt, dass ein Schiff der Küstenwache unterwegs zu uns ist. Nach drei bangen Stunden sehen wir ein nahendes Echo auf dem Radar, und kurz darauf werden alle Menschen an Bord des Küstenwachschiffs genommen. Die durchnässte und frierende Beiboot-Crew ist sichtlich erleichtert und froh, wieder an Bord zu sein: „Das war nicht schön.“
Lampedusa III: Ankerblues
Wegen Schlechtwetter wollen wir in Lampedusa in den Hafen, werden aber nicht reingelassen und müssen zwei Tage vor Anker liegen. Wir hatten uns alle auf eine Pizza-Pause gefreut, und die Crew-Moral leidet etwas.
Drei Menschen fehlen
Kurz darauf sind wir wieder unterwegs und erfahren über Funk von einem Seenotfall sehr nahe unserer Position. Die Stimme klingt aufgeregt, es sei viel Wasser im Boot. Wir passen sofort den Kurs an. Schon bei der Anfahrt können wir durch die Ferngläser beobachten, wie Menschen im Wasser ums Überleben kämpfen. Ihr Boot ist bereits gesunken. Drei Fischerboote versuchen, mit Seilen und Bojen die Schiffbrüchigen aus dem Wasser zu ziehen. Wir geben Vollgas und machen uns startklar für die Rettung. Als wir ankommen, sind die meisten schon an Bord der Fischerboote gezogen worden. Sie geben uns zu verstehen, dass drei Menschen fehlen. Wir beginnen sofort, mit der Nadir und dem Beiboot Suchmuster zu fahren, können aber zwischen schwimmenden Flipflops, Autoreifen und Kanistern niemanden mehr entdecken. Drei Hubschrauber kreisen nacheinander über dem Unfallort, unternehmen aber offensichtlich nichts. Später sagt eine Person aus der Crew, dass sie während der Suche gehofft hat, die Leichen nicht zu finden – und sich gleichzeitig für diesen Gedanken geschämt hat.
Als unsere Ärztin an Bord der Fischerboote klettert, stehen die Überlebenden unter Schock. Augen ins Nichts gerichtet, nass, zitternd, weinend oder apathisch. Einige liegen auf den Netzen, husten und ringen nach Luft. Wir evakuieren die drei kritischsten Notfälle, darunter eine bewusstlose Frau, mit der Trage auf die Nadir. Sie alle haben Wasser in der Lunge, teilweise auch ein Wasser-Benzin-Gemisch, und einen schwachen Kreislauf. Unser Medic-Team kann alle drei Frauen stabilisieren. Für die weniger kritischen medizinischen Notfälle bleibt bei diesem Einsatz keine Zeit. Ein Boot der Küstenwache kommt und nimmt alle Überlebenden mit nach Lampedusa. Drei Menschen fehlen.
Sechs Boote in einer Nacht und nicht genug Rettungswesten
Wir haben nicht mal Zeit aufzuräumen. In drei Seemeilen Entfernung warten bereits die nächsten Boote. Es sollen drei sein, aber schnell stellt sich heraus, dass es fünf sind, die im Radius von wenigen hundert Metern unkontrolliert treiben. Es ist inzwischen dunkel geworden. Wir verteilen Rettungswesten an die ersten beiden Boote, die etwas entfernt treiben und fahren dann rüber zu den anderen. Weil wir nicht genug Rettungswesten für so viele Menschen haben (wir zählen 193), müssen wir entscheiden, welches Boot am „stabilsten“ wirkt. Wir sprechen hier über Nussschalen aus Blech, ohne eigene Auftriebskraft, die bei Wassereinbruch binnen Sekunden sinken. Keines dieser Boote ist stabil. Wir fühlen uns schlecht, solche Entscheidungen treffen zu müssen.
Wir behalten das letzte Boot ohne Schwimmwesten mit dem Flutscheinwerfer nahe der Nadir im Blick. Aber auch die anderen Boote laufen Gefahr, im Dunkeln zu verschwinden. So statten wir sie mit Knicklichtern aus, und das Beiboot versucht. alle beisammenzuhalten. Als die italienische Küstenwache kommt, bittet sie uns, dass wir sie mit unserem Beiboot bei der Evakuierung zu unterstützen. Die gemeinsame Aktion dauert etwa zwei Stunden. Danach bergen wir unsere ca. 160 Rettungswesten aus den nun leer herumtreibenden Booten, sichern die Centifloats, kranen das Beiboot hoch und beseitigen das sonstige Einsatzchaos.
Wieder hat die Crew über 20 Stunden nicht geschlafen. Alle, die nicht auf Wache sind, fallen dreckig und müde in die Kojen, um zumindest kurz die Augen zu schließen, bevor wir nach ca. drei Stunden beim nächsten Einsatz ankommen. Am frühen Morgen finden wir den von Alarm Phone gemeldeten Notfall, ein Boot mit 35 Menschen aus Benin. Sie sind seit drei Tagen auf See. Es ist hell und windstill, die See ruhig. Die Menschen an Bord sind zuversichtlich und froh uns zu sehen, die Kommunikation klappt gut. Nach den Herausforderungen der vergangenen Nacht ist dieser vergleichsweise harmlose Einsatz eine Erleichterung. Wir spielen das übliche intransparente Theater mit Rom und Lampedusa durch, und nach viereinhalb Stunden sind alle sicher an Bord eines Küstenwachschiffs.
Es kann nur böse enden
Entgegen unseren Befürchtungen bleibt das Funkgerät den restlichen Tag weitestgehend still. Ein paar gemeldete Fälle werden von der Küstenwache betreut. Nachts erreicht uns über Alarm Phone ein Seenotfall an der Grenze zu tunesischen Territorialgewässern. Das Boot treibt demnach, die Menschen sind in großer Not. Die Position ist gut 20 Seemeilen entfernt. Wie errechnen die vermutliche Abdrift des Bootes und nehmen Kurs darauf. Im Morgengrauen erreichen wir ein großes Holzboot mit zwei Decks. Es treibt quer zu den ein Meter hohen Wellen.
Das Boot ist mit 130 Menschen komplett überladen. Die Menschen an Bord haben aufgegeben. Der Fahrer hat das Boot vor drei Tagen verlassen, seitdem treiben sie ausgeliefert in den rauen Wellen. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig. Einige springen über Bord und versuchen, zu unserem Beiboot zu schwimmen. Wir ziehen uns zurück und lassen sie zurück zum Boot schwimmen (Menschen, die nicht schwimmen können, springen nicht ins Wasser). Das ist hart, aber wenn man anfängt, die Leute aus dem Wasser zu ziehen, finden sich schnell Nachahmende und die Situation kann gefährlich schnell außer Kontrolle geraten.
Die Motoren funktionieren wohl noch, aber die Menschen sind völlig handlungsunfähig. Sie haben keine Kraft mehr, einen Start zu versuchen. Wir können keine Rettungswesten verteilen, weil im überladenen Boot dafür kein Raum ist und die Menschen nicht kooperieren. Wir wissen nicht, wie viele Menschen im unteren Deck eingepfercht hocken und wie viel Wasser darin steht. Das Boot hat keine Bilgenpumpe.
Wenn das Boot mit 130 Menschen ohne Rettungswesten kentert, gibt es definitiv Tote. Unsere Ressourcen reichen für so einen Fall nicht aus. Wir verteilen Rettungswesten an die über 20 Kinder an Bord und überlegen, wie wir weiter vorgehen sollen. Die Situation erscheint hoffnungslos. Die Wellen werden höher. Wir rufen in Rom an, um Druck zu machen – und erfahren zu unserer Überraschung, dass sie ein italienisches Schiff geschickt haben, das in zehn Minuten da sein wird.
Die Bergung wird nochmal sehr hässlich. Als die Küstenwache das Boot längsseits nimmt, bricht Panik aus. Die Menschen versuchen alle gleichzeitig, auf das Küstenwachschiff zu stürmen, sie trampeln übereinander. Kurz scheint es, als würde das Boot kentern. Menschen fallen ins Wasser, zwischen die Boote. Unser Beiboot zieht sie zu sich an Bord. Andere hängen an der Seite des Küstenwachschiffs und werden in den hohen Wellen zwischen den beiden Booten eingequetscht. Am Ende sitzen nur noch die Frauen und Kinder verängstigt im Boot – und ein Vater.
Als endlich alle an Bord sind und realisieren, dass das Martyrium ein Ende hat, bricht die Panik in Euphorie um. Die Menschen winken uns minutenlang und bedanken sich überschwänglich. Auch von uns fällt eine enorme emotionale Last ab. Es ist ein sehr bewegender Moment.
Europe – do your job!
Während wir in Lampedusa den Sturm auswettern, erreichen uns über Alarm Phone weiterhin Seenotfälle, deren Dringlichkeit und Tragik kaum auszuhalten ist. Vor allem in dem Wissen, dass gerade kein einziges Boot der zivilen Flotte im Einsatz sein kann und Malta nicht einschreiten wird. Wir sind wütend auf die EU, auf Malta, auf den Faschismus in Italien. Wir sind traurig und fassungslos darüber, dass im Mittelmeer wieder mehr Menschen denn je sterben. Obwohl es alle wissen, hilft niemand. Bangend verfolgen wir das Geschehen per Mail.
Die Zeit im Einsatzgebiet hat von der Crew körperlich sowie emotional alles gefordert und doch war uns stets bewusst, dass dies nichts ist, im Vergleich zu dem, was Menschen auf der Flucht auf sich nehmen, um ein Leben in Sicherheit in Europa zu finden. Wir sind tief beeindruckt von ihrem Mut und ihrer Stärke und betrachten es als Privileg, einigen von ihnen auf ihrer gefährlichen Reise solidarisch zur Seite stehen zu dürfen.
Fotos: Leon Salner, Friedhold Ulonska, Cat Spangehl
Deine Spende zählt – hilf uns zu helfen:
IBAN: DE 18 4306 0967 2070 8145 00
BIC: GENO DE M1 GLS
GLS Gemeinschaftsbank eG